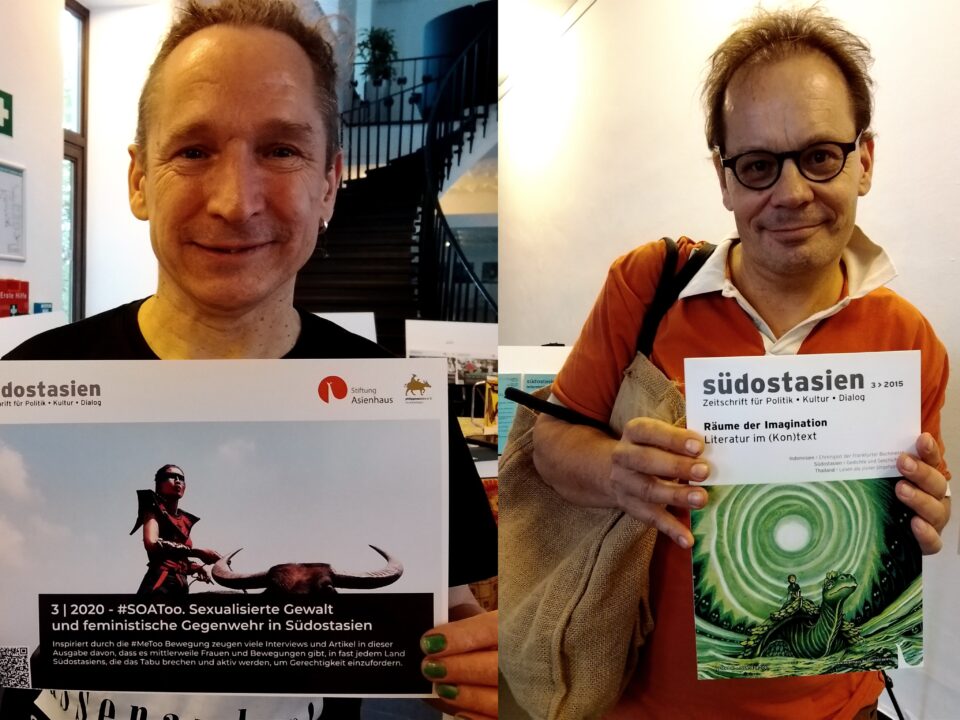Indonesisches Essen, das in Deutschland selten zu finden ist: Das bietet das Daur Lang in Köln © Cassie Sukmana
Indonesien/Thailand/Hongkong/Deutschland: Cassie Sukmana und Kwok-Fai Cheung haben sich in Köln mit dem Restaurant Daur Lang ihren Traum erfüllt, einen Mix aus Tradition und Nachhaltigkeit. Im Interview berichten sie über ihr Leben in der Diaspora – und natürlich über ihre Kochkünste.
Kwok-Fai Cheung ist in Berlin aufgewachsen, seine Eltern stammen aus Thailand und Hongkong. Er fing früh an, in der Gastronomie zu arbeiten und lernte dort schließlich Cassie kennen. Das Daur Lang gibt ihm neben seiner Leidenschaft fürs Kochen die Möglichkeit, selbständig zu arbeiten.
Was hat euch beide in die Gastronomie geführt?
Cassie (C): Wir haben vorher lange in Berlin gelebt, wo wir uns auch kennen gelernt haben. In Köln wohnen wir jetzt seit fünf Jahren. Ich habe bereits zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet, mein Mann sogar noch länger. Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben. Das haben wir nun zusammen umgesetzt.
Welche Einflüsse prägen die Küche, die ihr anbietet?
C: Wir haben unsere Vorstellungen in einem neuen Konzept verwirklicht. Dazu haben wir uns am Stil eines Asian Bistro orientiert, in dem wir eine Küche anbieten, die wir als ‚Hausmannskost’ bezeichnen würden. Also Gerichte, die sich in Deutschland sonst schwer finden lassen. Überwiegend servieren wir indonesische Speisen, da ich aus Indonesien komme und das dortige Essen sehr vermisst habe. Deswegen wollte ich für die Menschen das kochen, was ich selbst gern esse. Gerichte, die in Indonesien auf der Straße verkauft werden. Aber wir bedienen uns auch an Einflüssen aus der chinesischen und thailändischen Küche. Da mein Mann zur Hälfte Thailänder und zur Hälfte Hongkonger ist, überlasse ich das ihm.
Kwok-Fai (K-F): Wir wollten kein typisches 08/15-Restaurant mit Gerichten, die überall zu bekommen sind. Wir möchten den Menschen richtiges Heimatessen anbieten. Wichtig war uns auch ein wechselndes Menü, um für Abwechslung zu sorgen. Ansonsten wäre es schnell langweilig geworden.

Trotz des Lockdowns hat sich, wie hier im Kölner Stadtanzeiger zu lesen, schon eine Stammkundschaft entwickelt © Cassie Sukmana
War es für euch schwer, das Restaurant bekannt zu machen?
K-F: Ganz ehrlich: Restaurants wachsen wie Unkraut. An jeder Ecke entsteht etwas Neues, das macht es nicht einfacher. Ich würde nicht unbedingt als erstes ein Restaurant eröffnen, wenn ich neu nach Deutschland kommen würde. Aber durch unseren alternativen Ansatz sind wir in kurzer Zeit schon recht bekannt geworden und haben uns vor allem in der Südstadt von Köln einen Namen gemacht. Wir haben viele Stammkund*innen und kriegen oft Lob für das, was wir machen. Mich freut es sehr, dass die Menschen uns schon als Teil ihres Viertels betrachten.
Worauf habt ihr, neben der Menükarte, noch geachtet?
C: Uns war es wichtig, ein nachhaltiges Restaurant zu betreiben. Deswegen bieten wir, neben unserer Speisekarte, auch regionale Lebensmittel und wiederverwertete Dekorationsartikel in unserem Laden an. Diese werden beispielsweise aus Holz oder alter Pappe gefertigt und somit wiederverwertet. Zudem haben wir alle Möbel in unserem Laden gebraucht gekauft. Der Gedanke dahinter war, dass es bereits so viel Müll auf unserem Planeten gibt, dass wir nicht noch mehr davon produzieren, sondern vielmehr den vorhandenen dazu nutzen möchten, etwas Neues herzustellen.
Was bedeutet es euch, asiatische Gerichte anzubieten?
C: Wir kennen asiatische Gerichte durch unsere Familien und haben von deutscher Küche wenig Ahnung. Aber wir müssen auch kreativ sein, da wir vegetarische Gerichte anbieten. Fleisch kann man bei uns nur extra dazu bestellen. Typisch indonesische Gerichte wie Rendang [Rindfleisch mit speziellen Gewürzen in Kokosmilch, d.R.], sind schon schwer vegetarisch zu gestalten. Das Gericht wird in Indonesien mit Rindfleisch gekocht, bei uns mit Tofu. Allein für die Soße brauchen wir vier Stunden, deshalb bereiten wir es nur einmal im Monat zu. Viele unserer Gäste kannten das Gericht nicht, waren aber begeistert, nachdem sie es probiert hatten.
Wir bieten überwiegend vegetarisches und veganes Essen an, da übermäßiger Fleischkonsum einfach nicht nachhaltig ist. Unsere Karte spiegelt dabei genau das wider, was wir auch selbst zu Hause essen. Wir essen zwar Fleisch, aber sehr selten und ausgewählt. Deshalb möchten wir das Narrativ umkehren, dass vegetarisches Essen eine Besonderheit sei und Fleisch die Norm darstelle.

Ein Innenblick ins Daur Lang: Neben regionalen Lebensmitteln findet sich dort auch wiederverwertete Dekoration © Cassie Sukmana
Was verbindet ihr mit indonesischem Essen?
C: Indonesisches Essen steht für mich für Heimat. Ich kann, wenn ich esse, gedanklich zu meiner Familie reisen und viele Erinnerungen in mir wecken. Aber auch bei den meisten Kund*innen, die zu uns kommen und beispielsweise schon auf Bali waren, weckt unser Essen Erinnerungen. Viele freuen sich und schwelgen in Nostalgie an ihre schöne Zeit in Indonesien.
Hast Du Kontakt zu anderen Indonesier*innen in Deutschland?
C: Wir sind kein Teil einer größeren Gruppe, aber haben einige indonesische Freund*innen in Köln. Hier gibt es nicht so viele Indonesier*innen wie zum Beispiel in Berlin. Als ich nach Deutschland kam, wohnte ich in Berlin, um International Business zu studieren. Internationale Studierende mussten vor der Uni ein Studienkolleg besuchen. Dabei handelt es sich um ein Schuljahr, in dem Kenntnisse in Deutsch, Englisch, Mathe oder auch Wirtschaft aufgefrischt werden. Dort haben sich viele Indonesier*innen kennengelernt, aber auch Menschen anderer Nationalitäten.
Später bin ich nach Köln umgezogen und habe dort mein Studium beendet. Mein Bruder hat dort gewohnt, so konnte ich ihm näher sein. Mittlerweile ist er wieder nach Indonesien gezogen. In Köln konnten wir uns sehr schnell einleben. Es geht uns gut hier, was auch ein Grund war, das Daur Lang zu eröffnen. Wenn alles nach Plan läuft, bleiben wir auch die nächsten Jahre hier.
Was bedeuten Restaurants für die indonesische Diaspora in Deutschland?
C: In Deutschland gibt es mehrere indonesische Restaurants. Vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten. In Köln sind es momentan noch drei weitere. Das älteste davon gibt es schon seit 35 Jahren. Das wurde schon von der Großmutter des jetzigen Inhabers geführt. Einige Indonesier*innen haben direkt, nachdem sie nach Deutschland kamen, indonesische Läden oder Restaurants eröffnet. In Hamburg gibt es auch ein Restaurant und sogar einen indonesischen Lebensmittelladen, den größten in Deutschland.
Wie ist Dein Verhältnis zu Deinen Verwandten in Indonesien?
C: Ich fliege circa einmal alle zwei Jahre nach Indonesien. Meine ganze Familie wohnt dort, deshalb wohne ich quasi alleine hier. Ich vermisse sie alle sehr. Aber der technische Fortschritt macht es auf jeden Fall einfacher, den Kontakt zu halten. Messenger Dienste haben es sehr viel leichter und günstiger gemacht, zu telefonieren. So ist es definitiv erträglicher. Aber sobald die Pandemiesituation es zulässt, würde ich gerne wieder nach Indonesien reisen.
K-F: Bei mir ist es, dadurch dass ich in Berlin aufgewachsen bin, etwas einfacher. Meine Eltern und der engste Familienkreis lebt noch dort. Meine Großeltern, Onkel und Tanten jedoch leben in Thailand und in Hongkong. Daher kann ich nachvollziehen, wie weit für Cassie die Distanz zu ihrer Familie ist.

Die Visitenkarte des Daur Lang aus recycelter Pappe. © Cassie Sukmana
Habt ihr das Gefühl, das Menschen aus Südostasien mittlerweile besser repräsentiert in Deutschland sind?
C: Die Repräsentation nimmt auf jeden Fall zu, wir fühlen uns mehr willkommen. Ich kann es natürlich nur bedingt vergleichen, da ich erst seit fünf Jahren in Köln lebe. Hier sind wir glücklicher als in Berlin, denn die Leute sind netter und aufgeschlossener. Mein Mann kann das allerdings besser einschätzen, da er in Deutschland aufgewachsen ist. Am Anfang der Corona-Zeit haben die Anfeindungen gegen uns deutlich zugenommen.
K-F: Da kamen teilweise richtig rassistische Sprüche. Das war schon sehr fies, nett gesagt. Mittlerweile schalte ich allerdings einfach auf stumm und höre solchen Sprüchen nicht mehr zu. Viel passiert auch durch fehlende Bildung und Falschinformationen. Da wird gerne ein Bild aus Boulevardmedien übernommen, dass das Virus von Asiat*innen stamme. Aber mal im Ernst: Es gab genug andere Krankheiten mit vielen Toten. Zum Beispiel die Influenza-Grippe. Nur stammte diese eben aus Europa, nicht aus Asien. Deswegen sorgte das nicht für eine vergleichbare Diskriminierung.
Habt ihr auch früher schon derart viele Diskriminierungserfahrungen gemacht?
K-F: Damals vor 25 Jahren, als Asiate in Berlin aufzuwachsen, war hart. Niemand hat Dich wahrgenommen. Ich hatte teilweise das Gefühl, ein Nichts zu sein. Aber mittlerweile hat sich einiges geändert. Jüngere Asiat*innen haben zum Glück nicht mehr die gleichen Probleme, wie ich damals. In der Großstadt gibt es so etwas heutzutage nur noch selten.
C: Ich glaube auch, dass sich das mediale Bild von Asien gewandelt hat. Heutzutage wird deutlich weniger rassistisch über Asiat*innen gesprochen, als es früher noch der Fall war.
Welche Herausforderungen bringt die Corona-Pandemie für das Restaurant mit sich?
C: Das Daur Lang haben wir seit circa einem Jahr. Leider haben wir kurz vor dem Beginn der Corona-Pandemie eröffnet, das war ein denkbar schlechter Zeitpunkt für uns. Und jetzt, ein Jahr später, befinden wir uns immer noch in der Pandemie. Es gibt wirklich leichteres, aber da müssen wir durch. Wir bieten weiterhin unsere Gerichte zum Abholen an und erhalten dafür auch viel Zuspruch. Wir hoffen natürlich, dass es wieder Richtung Normalzustand geht.
K-F: Ich bin mit unserem Restaurant an sich auf jeden Fall zufrieden. Mit dem was wir schon erreicht haben – Mit der aktuellen Situation natürlich weniger. Aber das geht wahrscheinlich Allen so. Viele Leute sprechen uns Mut zu und sagen uns, dass wir durchhalten sollen. Dafür lohnt es sich definitiv, weiterzumachen.
Zum Weiterlesen:

„Zwischen mir und meinen Lieben liegt das Essen“
Südostasien – Essen spielt in Diasporagemeinden oft eine wichtige Rolle. Vicky Truong schildert, wie sie durch Essen die kulturellen, generationsbedingten und sprachlichen Barrieren als Tochter südostasiatischer Migrant*innen durchbricht.
Das Zuhause befindet sich nicht an einem Ort
Europa/Indonesien – Der politische Genozid von 1965 machte zahlreichen Indonesier*innen im Ausland eine Rückkehr unmöglich. Unsere Autorin befragte eine Familie zu ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen in der Diaspora in Ungarn.

Wohin das Meer uns trägt
Indonesien/Deutschland – Auf hoher See um die Welt zu reisen und damit die Familie zu unterstützen, davon träumt so mancher Indonesier. Beim indonesischen Seemannsclub in Hamburg treffen sich Menschen, die dies in die Tat umgesetzt haben und denen die Hafenstadt zur zweiten Heimat wurde.